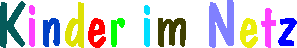
 |
Vorüberlegungen - Warum kein klassischer Pretest?
|
 |
|
Vor der Hauptuntersuchung war der Fragebogen zunächst auf seine Tauglichkeit
zu überprüfen. Insbesondere weil es an entsprechenden Erfahrungen mit dieser
Form der Befragung von Kindern fehlt, war eine Voruntersuchung unabdingbar.
Allerdings bot sich ein klassischer Pretest unter denselben Bedingungen wie bei der
Hauptuntersuchung für meine Umfrage nicht an. (303) Wesentlicher Grund dafür:
die anzunehmende geringe Zahl von Kindern, die das Internet nutzen, verbunden
mit den eingeschränkten Möglichkeiten für die Verbreitung eines entsprechenden
Teilnahmeaufrufs. Um ausreichend Antworten von Kindern aus allen Altersklassen
zu bekommen, wäre schon für den Pretest ein erheblicher "Werbeaufwand" erforderlich
gewesen. Ich hätte Mitteilungen verschicken müssen an mehrere Mailinglisten,
Newsgroups sowie ausgewählte Schulen. Die Zahl der Newsgroups und Mailinglisten,
die sich einerseits an Kinder direkt, andererseits an Betreuer von
Kindern in der angesprochenen Altersgruppe richten (vor allem Grundschullehrer),
ist jedoch verhältnismäßig gering. Also hätte sich ein späterer Teilnahmeaufruf
für die Hauptuntersuchung an gleicher Stelle nicht vermeiden lassen. Damit
aber wären vermutlich dieselben Respondenten erreicht worden wie in der Voruntersuchung.
Bei solch einer Vorgehensweise wäre es ferner kaum möglich gewesen,
aus den Beteiligungsquoten in den unterschiedlichen Altersklassen Schlüsse zu
ziehen für die Gestaltung des Fragebogens. Angenommen, nur sehr wenige
oder gar keine Kinder unter zehn Jahren hätten sich an der Voruntersuchung beteiligt.
Hätte das dann geheißen, daß es generell wenige Online-Kids in dieser
Altersklasse gibt? Oder wäre vielmehr davon auszugehen gewesen, daß der
Fragebogen dem Medienverhalten dieser Altersgruppe unangemessen konzipiert worden ist
und aus diesem Grund die Kinder nicht erreicht hat?
Um mir einen Überblick zu verschaffen, ob der Fragebogen in allen
Einzelheiten verstanden wird und ob die Kinder mit der neuartigen Befragungssituation
klarkommen, hielt ich es für angemessener, einige Probanden beim testweisen
Ausfüllen zu beobachten. Anhand ihrer Reaktionen und eventuellen Nachfragen,
so die Prämisse, ließe sich am ehesten eruieren, wie der Fragebogen zu
optimieren wäre. Außerdem galt es, herauszufinden, inwieweit sich die Kinder
überhaupt darüber im klaren sind, daß sie mit dem Computer interagieren müssen,
um die gestellten Fragen zu beantworten. Ein weiterer Vorteil dieser
Vorgehensweise hinsichtlich der Validität des Instrumentes: Durch mündliche
Kommentare der Kinder während der Voruntersuchung und ggf. gezielte Nachfragen
ließ sich herausfinden, ob die Antworten der Kinder mit ihrem
tatsächlichen Online-Nutzungsverhalten übereinstimmten.
Ich habe bei der Auswahl von Testpersonen für die Voruntersuchung darauf
verzichtet, die gesamte Altersspanne der 6- bis 13jährigen abzudecken und mich vielmehr
auf Kinder der Grundschulklassen drei und vier beschränkt. Würde der Fragebogen
von diesen Kindern in allen Einzelheiten verstanden, so meine Annahme,
könne davon ausgegangen werden, daß die Methode, die Formulierung der Fragen und
die gestalterische Aufbereitung auch dem kognitiven Entwicklungsstand älterer Kinder
angemessen ist. Kinder unter acht Jahren habe ich - mit einer Ausnahme - nicht
in die Voruntersuchung einbezogen. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt,
gehören zwar auch diese jüngeren Kinder zum Adressatenkreis der Umfrage.
Es ist jedoch davon auszugehen, daß sie aufgrund ihrer mangelnden Lesekenntnisse
ohnehin nur mit Unterstützung eines Erwachsenen der Beantwortung der Fragen
gewachsen sein würden. (304)
Das Resultat des Versuchs, das einzige siebenjährige
Kind der Testgruppe den Fragebogen ausfüllen zu lassen, bestätigte mich
in dieser Annahme: Zwar konnte der Junge, nachdem ich ihm die Fragen
vorgelesen hatte, anhand der Grafiken die Antwortalternativen, die seinem
Online-Verhalten entsprachen, zumindest teilweise identifizieren und per
Mausklick auswählen. Ohne diese Unterstützung jedoch hätte er keine
der Fragen beantworten können.
 |
Fußnoten |
 |
|
Benutzen Sie die
 Buttons, um zum Text zurückzukehren.
Buttons, um zum Text zurückzukehren.
 (303)
Vgl. zur Konzeptionierung und Durchführung von Pretests die allgemeinen Ausführungen
bei Friedrichs, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung. 14. Aufl.
Opladen 1990, S.153ff. sowie Atteslander, Peter u.a., a.a.O., S.339ff.
(303)
Vgl. zur Konzeptionierung und Durchführung von Pretests die allgemeinen Ausführungen
bei Friedrichs, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung. 14. Aufl.
Opladen 1990, S.153ff. sowie Atteslander, Peter u.a., a.a.O., S.339ff.
 (304)
Vgl. die Diskussion in Kapitel 2.2.1.
(304)
Vgl. die Diskussion in Kapitel 2.2.1.
© Tobias Gehle, 1998
 |
Bookmark für diese Seite: http://www.netz-kids.de |
 |
|
[Startseite] [Abstract] [Inhalt] [Literatur] [Fragebogen]
[Download] [Kontakt] [nach Hause]
![]() (303)
Vgl. zur Konzeptionierung und Durchführung von Pretests die allgemeinen Ausführungen
bei Friedrichs, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung. 14. Aufl.
Opladen 1990, S.153ff. sowie Atteslander, Peter u.a., a.a.O., S.339ff.
(303)
Vgl. zur Konzeptionierung und Durchführung von Pretests die allgemeinen Ausführungen
bei Friedrichs, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung. 14. Aufl.
Opladen 1990, S.153ff. sowie Atteslander, Peter u.a., a.a.O., S.339ff.![]() (304)
Vgl. die Diskussion in Kapitel 2.2.1.
(304)
Vgl. die Diskussion in Kapitel 2.2.1.